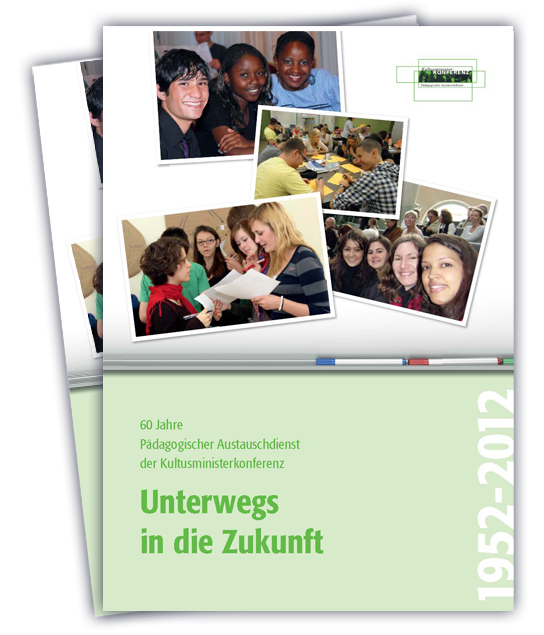Die Gründung
Der PAD nahm seine Arbeit im April 1952 auf, zunächst als Zweigstelle im Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) in Bonn. Zum 1. Oktober 1955 wurde er dem Sekretariat der Kultusministerkonferenz angegliedert. Anfangs führte er zunächst Programme fort, deren Ursprünge auf das frühe 20. Jahrhundert zurückreichen – den Austausch für angehende Lehrerinnen und Lehrer (Fremdsprachenassistenten). Schon bald aber wurde er auch mit neuen Aufgaben beauftragt. Zu nennen sind etwa der deutsch-amerikanische Lehreraustausch seit 1952 und die Beratungsstelle für Studienreisen ausländischer Schüler- und Jugendgruppen, die 1959 eingerichtet wurde. Mit dem Internationalen Preisträgerprogramm und der Vermittlung von Sprachkursen werden dabei sprachbegabte Schülerinnen und Schüler aus heute weltweit rund 90 Staaten nach Deutschland eingeladen, die sich im Unterrichtsfach Deutsch ausgezeichnet haben. Hinzu kam 1960 das Weiterbildungs- und Hospitationsprogramm für Lehrerinnen und Lehrkräfte.
Die Programme standen einerseits im Kontext der Neuorientierung des deutschen Schulwesens, waren andererseits aber auch Instrumente der damaligen Auswärtigen Kulturpolitik, die in den Jahren der schnellen Konsolidierung des westdeutschen Staates und des Wirtschaftswunders formuliert wurde.
60 Jahre PAD
Anlässlich unseres Jubiläums haben wir einen Blick in unsere Geschichte und auf Gegenwart geworden. Hier mehr erfahren.
Wachstum und Erweiterung
Die Programme des PAD nahmen in ihrem Umfang schnell zu. Die Zahl der deutschen Fremdsprachenassistenten beispielsweise, die an einer Schule im Ausland assistieren, stieg von 256 im Schuljahr 1956/57 auf 794 im Schuljahre 1966/67 und erreichte in den frühen 2010er Jahren die Zahl von rund 1.100. Im Gegenzug erhöhte sich die Zahl der ausländischen Studierenden, die an einer Schule in Deutschland assistieren.
Ende der 1970er bzw. Anfang der 1980er Jahre bekam der PAD zudem innovative Programme übertragen: Dazu zählten das europäische Programm ARION, das sich an Mitarbeiter der Schulaufsicht und Schulverwaltung richtete, und das German American Partnership Program (GAPP), das durch das Auswärtige Amt initiiert wurde und seitdem den deutsch-amerikanischen Schüleraustausch fördert. In GAPP sind heute rund 760 Schulpartnerschaften registriert. Der politische Umbruch seit 1989/90 eröffnete zudem die Möglichkeit für Programme mit Schulen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie in den Staaten Mittel-, Süd- und Osteuropas. Hinzu kamen verstärkt Programme mit Israel.
Unsere Partner und Förderer
Die Programme des PAD werden finanziert aus Mitteln der Länder, des Auswärtigen Amtes und der EU-Kommission sowie verschiedener Stiftungen.
Europäische Bildungskooperation
Die europäische Bildungskooperation erfuhr 1995 einen nachhaltigen Impuls und prägt den PAD heute in besonderer Weise: Seinerzeit bestimmten die Kultusminister der Länder den PAD zur Nationalen Agentur für EU-Programme im Schulbereich. Aus SOKRATES mit seinen Aktionen COMENIUS, LINGUA und ARION wurde 2007 das Programm für lebenslanges Lernen, das 2014 im Programm Erasmus+ aufgegangen ist und heute auch das europäische Schulnetzwerk eTwinning für den digitalen Austausch umfasst. Die aktuelle Programmgeneration von Erasmus+ fördert die Mobilität von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften und läuft bis Ende 2027.
Neue Initiativen
Neue Perspektiven eröffnen sich seit 2008 für Schulpartnerschaften durch die Initiative Schulen: Partner der Zukunft (PASCH) des Auswärtigen Amtes. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von rund 1.500 Schulen weltweit, in denen Deutsch als Unterrichtssprache besonders fest verankert ist. Dem PAD kommt in diesem Netzwerk unter anderem die Aufgabe zu, Partnerschaften und Projekte zwischen den Schulen im Ausland und in Deutschland anzubahnen und zu fördern. Durch das Programm kulturweit vermittelt der PAD außerdem seit 2009 junge Freiwillige für mehrmonatige Aufenthalte an Auslandsschulen.
Der PAD hat aktuelle Entwicklungen stets aufgenommen und unterstützt – sei es im Rahmen des Bildungsnetzwerkes China, das gemeinsame Projekte für Schülerinnen und Schüler aus beiden Ländern unterstützt hat, oder auch durch die Initiative UK-German Connection für den deutsch-britischen Austausch, die für den Schulbereich in Deutschland seit 2023 mit einem Büro im PAD angesiedelt ist.
Austausch trotz Corona
Wie viele anderen Institutionen und Organisationen und vor allem Schulen hat die Coronapandemie auch die Austauschprogramme des PAD seit dem Frühjahr 2020 für viele Monate erheblich eingeschränkt, wenn nicht sogar zeitweise unmöglich gemacht. Nach dem Ende der Beschränkungen zeigt sich allerdings: Das Interesse Austausch gerade auch im Schulbereich ist ungebrochen. Darüber freuen wir uns - denn Austausch bildet.
Unterwegs in die Zukunft
Anlässlich unseres 60jährigen Bestehens haben wir 2012 nicht nur auf unsere Geschichte zurückgeblickt, sondern auch nach vorne geschaut. Getreu der Maxime: Nur wer bereit ist, Neues zu erproben, kann Innovation fördern. Einige wenige Exemplare unserer dazu erstellten Veröffentlichung sind noch vorhanden. Interesse? Schicken Sie uns eine E-Mail.